Wie liest man allenthalben? Das Jahr neigt sich seinem Ende zu. In der Tat. In nur wenigen Tagen, in fünfen, um genau zu sein, schreiben wir das Jahr Zweitausendundneunzehn. Dann wird das alte Jahr ausgedient haben. Der eine oder andere Rückblick noch, hier und dort eine Würdigung, ein paar Listen von Menschen, die das Jahr nicht überlebt haben, das war’s dann. Dann gilt Neunzehn statt Achtzehn. Für mich auch. Natürlich. Neues Jahr, neues Glück. Meine persönliche Bilanz am Ende des zur Neige gehenden Jahres fällt eher beschattet aus, düster, negativ, zwiespältig. Nein, nicht Trump, Orban oder Merkel, nicht das Siechtum der SPD, nicht der Erste FC Köln in Liga Zwei, nicht die ganz kleine Koalition, nicht Herr Merz oder Frau Nahles, nicht der Brexit oder gelbe Westen oder Macron, nicht die vergeigte Fußballweltmeisterschaft, all das nicht. Nicht die Politik, groß oder klein, nicht der Sport, nicht Wermelskirchen, nicht das Fernsehen. Ich habe mich allzu oft auf Friedhöfen rumtreiben müssen im ablaufenden Jahr, leiblich und gedanklich. Mein kleiner Bruder ist gestorben, Bernd, knapp dreizehn Monate jünger als ich. Bernd, in der Familie und von Freunden Berni gerufen, wurde nur sechsundsechzig Jahre alt. Wir haben unsere Kindheit zusammen verbracht, wie zwei Brüder ihre Kindheit in diesen Zeiten verleben konnten. Oft einig, oft streitend, fast immer konkurrent. Das alles nicht selten körperlich ausgetragen. Als junge Erwachsene begannen wir, uns auseinanderzuleben. Die Interessen waren und wurden unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Ihm war die Weltrevolution zu blöd, mir seine nachpubertären Saufkumpane nicht geheuer. Ich fand die Bundesliga nicht mehr prickelnd, er mißtraute meinen Freunden, die selbst im Schwimmbad einen Band von Marx oder Lenin lasen und unentwegt Unterstreichungen vornahmen, weil das doch was hermachte. Er fand meine Musik bekloppt, ich konnte seinem Geschmack nicht das Geringste abgewinnen. Kurzum, wir haben uns auseinandergelebt. Mehr noch: Später waren wir uns nicht mehr grün. Ich war ihm böse. Er mir. Das hat mit seinem Umgang mit seiner Frau und seinen Kindern zu tun. Viel später dann hat er zum zweiten Mal geheiratet und ist ins Ruhrgebiet gezogen. Lange Jahre, Jahrzehnte haben wir uns so gut wie nicht gesehen oder gesprochen. Ganz selten miteinander telefoniert. Kein Chat, kein Facebook, Funkstille. Und nun ist er vor wenigen Monaten gestorben, dort im Ruhrgebiet. Zur Beerdigung war ich nicht eingeladen. Nein, das Kapitel „Kleiner Bruder“ ist noch nicht abgeschlossen. Ich brauche die Beerdigung nicht, kein Grab, keinen Kranz und keine Karte, um mich mit dem kleinen Bruder in mir zu befassen. Trotz des Zwistes, der gravierend war, ist es mir offenbar noch nicht gelungen, meinen kleinen Bruder abzustreifen. Ich trauere um ihn. Ich denke an ihn. Er erinnert mich an die gemeinsame Kindheit, an die Eltern, an längst vergangene Zeiten von Jugend und Wildheit. Ich bin nun der Letzte aus dieser kleinen Familie. Weil Berni viel zu früh gestorben ist. Er hätte gewiß noch schöne Jahre verdient gehabt. Ich vermisse ihn. Anfang November ist dann meine Schwiegermutter im gesegneten Alter von achtundachtzig Jahren gestorben. Sie kränkelte ganz am Ende ihres Lebens ein wenig, blickte allerdings zufrieden zurück in die Zeit mit Ihrem Mann, auf ihr Berufsleben, ihre Familie, die Jugend und Kindheit. Sie habe ein schönes Leben gehabt, hat sie mir in ihren letzten Tagen deutlich gesagt. Von Sterben war eigentlich noch nicht die Rede. Bis vor einem Jahr hat sie uns noch regelmäßig in Wermelskirchen besucht, mit dem eigenen Auto aus Köln kommend. Ich hätte gerne noch ein wenig Zeit mit ihr zugebracht, ihr den Altenberger Dom gezeigt, den sie unbedingt noch einmal besuchen wollte. Wir hatten uns vorgenommen, noch ein Eis miteinander zu essen. Eine Zigarette wollte sie noch rauchen, draußen auf der Terrasse. Pläne. Und dann ist, kurz nach meiner Schwiegermutter, mein Onkel Max gestorben. Vierundachtzig Jahre alt. Einst ein Kerl wie ein Baum. Glasbläser. Ein Pimmock, wie die Kölner zu sagen pflegen, ein Fremder, zugereist aus dem Osten. Von meiner immer freundlichen Tante, die sich mit sechzehn in diesen jungen Kerl verliebt hatte, nach und nach in einen waschechten Rheinländer verwandelt. Einen, der mit zum Karnevalszug ging, erst in Westhoven, einem Stadtteil im Norden von Porz, dann am Bottermaat, der Porzer Karnevalshochburg. Heute alles zum Stadtgebiet Kölns gehörend. Ein Kölner von Gemüt, der seine Herkunft aus Danzig nie verleugnete, immer freundlich, immer zugewandt. Niemals laut. Niemals böse. Niemals falsch. Ein Muster, diese Ehe von Tante und Onkel, ein Paradebeispiel für das kleine Glück. Ich habe eine Grabrede für ihn gehalten, weil meine Tante mich darum gebeten hatte. Eine Erfahrung, die ich so bald nicht wieder machen möchte. Drei Todesfälle, wie es sachlich-bürokratisch heißt, zwei Beerdigungen, drei mal Kummer, drei mal Trauer, drei mal Ausnahme. Zudem war ich in der ersten Jahreshälfte zwei mal kurz hintereinander im hiesigen Krankenhaus, im Frühjahr und im Frühsommer, beide Male mit dem Notarzt dorthin verfrachtet. Kein gutes Jahr geht zu Ende. Ich setze auf das Jahr Zweitausendundneunzehn.
Zweitausendundachtzehn
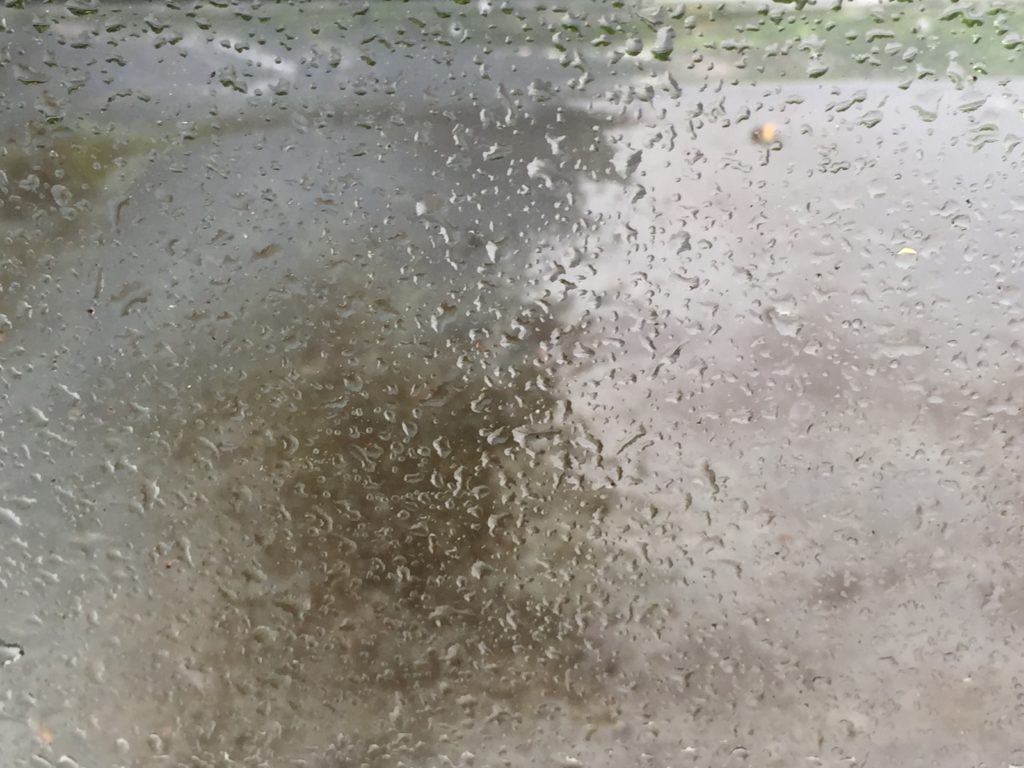
Du weißt es. Alles wird gut, guter oder am Gutesten!